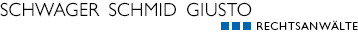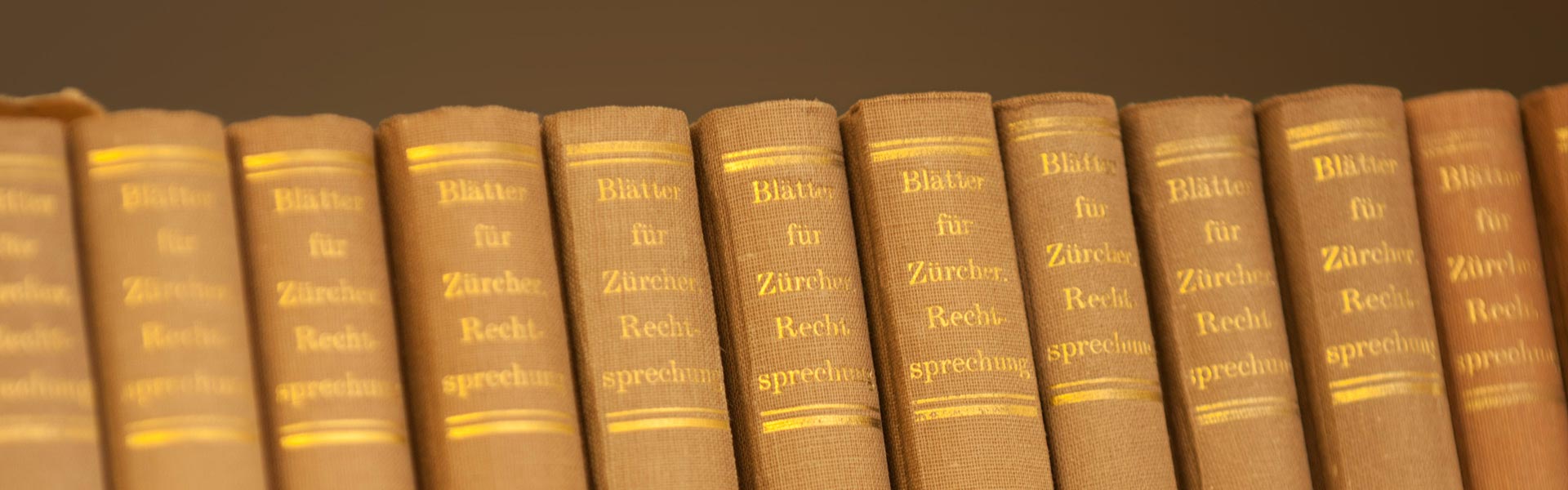Die Abänderung eheschutzrichterlicher Anordnungen bzw. richterlich
genehmigter Eheschutzvereinbarungen kann verlangt werden, wenn sich die
tatsächlichen Verhältnisse, die dem früheren Entscheid zugrunde lagen,
erheblich und dauernd verändert haben oder wenn das Gericht beim Erlass der
ursprünglichen Regelung von tatsächlichen Voraussetzungen ausging, die sich
nachträglich als unrichtig erwiesen haben (Art. 276 und Art. 268 ZPO).
Gestützt auf Art. 173 Abs. 1 ZGB kann das Gericht auf Begehren eines
Ehegatten Geldbeträge an den Unterhalt der Familie festsetzen. Die
Leistungen können für die Zukunft sowie für ein Jahr vor der Einreichung des
Begehrens gefordert werden. Ebenso setzt das Gericht auf Begehren eines
Ehegatten den Betrag für jeden Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt, die
Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Geschäft hilft.
Das Bundesgericht musste sich kürzlich mit einem Foul in einem
Amateurfussballspiel zu befassen: Ein Spieler hatte seinen Gegner mit
gestrecktem Bein zu Boden gebracht. Die Folge war ein Knöchelbruch. Während
der Schiedsrichter das Foul mit einer gelben Karte ahndete, bestätigte das
Bundesgericht die Verurteilung des Foulspielers durch die kantonalen
Instanzen wegen einfacher Körperverletzung. Die höchsten Richter begründeten
ihren Entscheid damit, dass sich die in einer Sportveranstaltung zu
beachtenden Sorgfaltspflichten aus den anwendbaren Spielregeln und dem
allgemeinen Schädigungsverbot ergeben würden. Die Spielregeln würden
insbesondere dazu dienen, Unfälle zu vermeiden und die Spieler zu schützen.
Aufgrund der Tatsache, dass der Schiedsrichter den Spieler verwarnt hat, sei
von einer gewichtigen Verletzung der Spielregeln auszugehen, die ohne
Rücksicht auf die Gefahr oder die Folgen für den Gegner begangen wurde.
Aufgrund der Gefährlichkeit der Aktion sei die Verletzung der zum Schutz der
anderen Spieler aufgestellten Spielregeln als schwer einzustufen, weshalb
keine Einwilligung des Gefoulten in das mit einem Fussballspiel verbundene
Risiko einer Körperverletzung angenommen werden könne.
Gemäss Art. 172 Abs. 3 ZGB trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten
die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Im Hinblick auf die Aufnahme des
Getrenntlebens legt das Gericht gestützt auf Art. 176 ZGB die
Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten
fest. Es wird zudem die Benützung der Wohnung und des Hausrates geregelt und
die Gütertrennung angeordnet, wenn es die Umstände rechtfertigen. Haben die
Ehegatten minderjährige Kinder so regelt das Gericht auch die Zuteilung der
Obhut über die Kinder sowie die Betreuungsanteile des nicht hauptsächlich
betreuenden Elternteils. Der Massnahme Katalog in Art. 176 ZGB ist
abschliessend. Es können keinen weiteren Anordnungen getroffen werden,
selbst dann nicht, wenn diese dem Gericht im konkreten Einzelfall als
angemessen erscheinen würden. Beispielsweise eine Erhöhung der
Hypothekarschuld zur Finanzierung von Anwalts- und Prozesskosten kann gegen
den Willen des anderen Ehegatten im Eheschutzverfahren mangels gesetzlicher
Grundlage nicht erwirkt werden.
Ein Unterhaltsvertrag kann lediglich aufgrund eines wesentlichen Irrtums im
Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR unverbindlich erklärt werden. Auf diesen kann
sich ein Vertragsschliessender im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR nur
berufen, wenn subjektive und objektive Wesentlichkeit sowie deren
Erkennbarkeit für den Erklärungsgegner vorliegen. Subjektive Wesentlichkeit
ist dann zu bejahen, wenn für den Erklärenden die falsche Vorstellung
bezüglich des Sachverhaltes unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua
non) für die Willensbildung gewesen ist. Objektive Wesentlichkeit liegt vor,
der nach loyalem Geschäftsverkehr zugrunde gelegte Sachverhalt als
notwendige Grundlage des Vertrages angesehen werden kann. Schliesslich muss
die Bedeutung des irrtümlich festgestellten Sachverhaltes für den
Vertragspartner des Irrenden erkennbar gewesen sein. Liegen die
Voraussetzungen eines Grundlagenirrtums vor, so ist der Vertrag gemäss Art.
23 ff. OR für die irrende Partei unverbindlich.