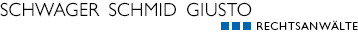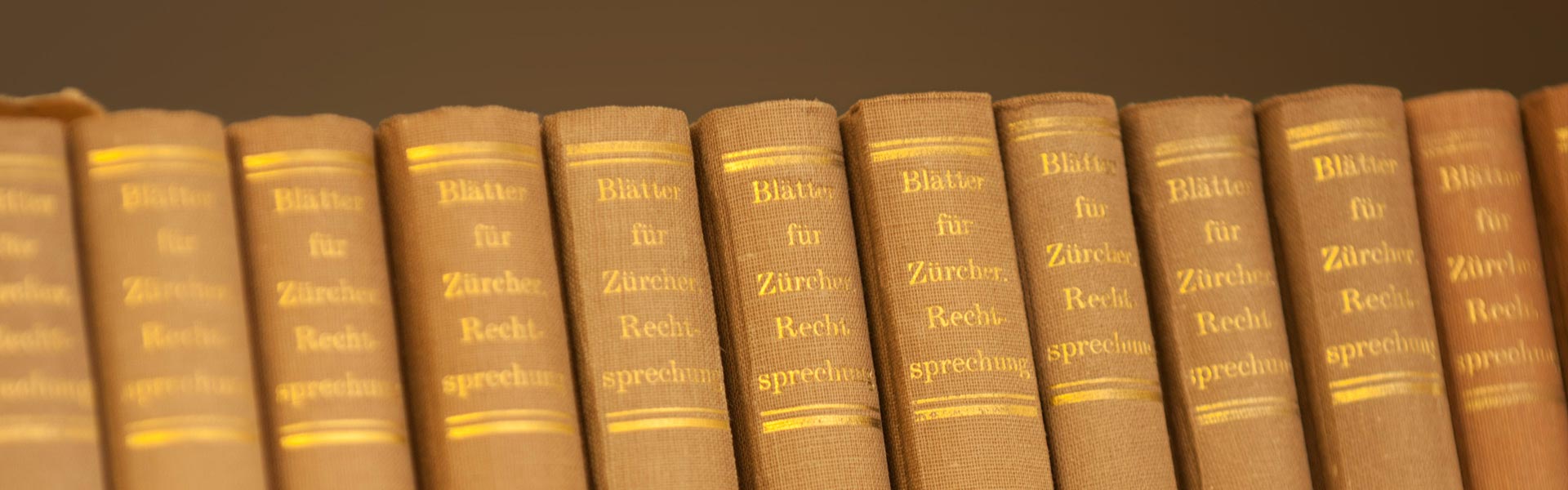Gemäss Art. 301a Abs. 2 ZGB muss ein Elternteil, der mit dem Kind seinen
Aufenthaltsort ins Ausland verlegen will oder der Wechsel des
Aufenthaltsortes erhebliche negative Auswirkungen auf die Ausübung des
persönlichen Verkehrs des anderen Elternteils haben wird, die Zustimmung des
anderen Elternteils, des Gerichts oder der KESB einholen.
Wird der Aufenthaltsort des Kindes ohne Zustimmung des anderen Elternteils
verlegt, hat der andere Elternteil effektiv keine Möglichkeit, den Wechsel
des Aufenthaltes des Kindes zu verhindern oder rückgängig zu machen. Beruht
der Aufenthaltswechsel auf einem missbräuchlichen Verhalten des
hauptbetreuenden Elternteils, so kann eine Obhutsumteilung des Kindes an den
anderen Elternteil vom Gericht geprüft werden.
Dies setzt voraus, dass das Kind beim anderen Elternteil besser aufgehoben
wäre und dieser das Kind tatsächlich betreuen kann und will. Das
Bundesgericht hat in einem Entscheid vom 6. November 2017 festgestellt, dass
nicht einmal eine Weisung der KESB oder des Gerichts an den hauptbetreuenden
Elternteil gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB den Wegzugsentscheid zielführend
verhindern kann.
Die Vaterschaft kann vom Ehemann innert der Verwirkungsfrist von 5 Jahren
seit der Geburt des Kindes angefochten werden (Art. 256 ff. ZGB, Art. 256c
Abs. 3 ZGB). Eine Anfechtungsklage ist auch nach Ablauf der Verwirkungsfrist
möglich, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt werden kann.
Laut Bundesgerichtsentscheid vom 10. Januar 2018 genügt es, wenn der Ehemann
und rechtliche Vater bisher nicht an seiner biologischen Vaterschaft
zweifelte. Kommen dem Ehemann nachträglich Zweifel, hat er umgehend, das
heisst innert Monatsfrist zu reagieren und eine Klage auf Aufhebung der
Vaterschaft beim Gericht einzureichen.
Im Entscheid vom 16. August 2018 hat sich das Bundesgericht mit dem
Kontaktrecht von Grosseltern gestützt auf Art. 274 Abs. 1 ZGB befasst.
Notwendig ist, dass sich die Kontakte Dritter positiv auf das Kind
auswirken. Bei Grosseltern darf im Allgemeinen davon ausgegangen werden,
dass der persönliche Verkehr dem Wohl des Kindes entspricht. Bestehen
Konflikte zwischen den Grosseltern und einem Elternteil, so ist
entscheidend, dass die Beteiligten allfällige Differenzen nicht auf eine das
Kindeswohl gefährdende Art und Weise austragen.
Mit Urteil vom 13. Juni 2018 hat das Bundesgericht entschieden, dass bei
einer Schenkung von Bargeld durch einen Elternteil an einen verheirateten
Nachkommen vermutet wird, dass diese dem eigenen Nachkommen – und nicht etwa
den Ehegatten gemeinsam – zukommen soll. Es handelt sich dabei um eine
natürliche Vermutung, wobei der Vermutungsgegner den Gegenbeweis erbringen
kann.
Das Bundesgericht hat in einem Entscheid vom 14. Juni 2018 die Grundsätze
beim Umzug eines Elternteils festgelegt. Die gemeinsame elterliche Sorge
darf die Eltern ihrer Niederlassungsfreiheit nicht berauben, indem sie von
einem Umzug abgehalten werden. Es ist folglich nicht entscheidend, ob es für
das Kind vorteilhafter wäre, wenn beide Eltern am angestammten Ort
verbleiben würden, sondern ob das Wohl des Kindes besser gewahrt ist, wenn
es mit dem wegzugswilligen Elternteil mitgeht oder wenn es künftig beim
zurückbleibenden Elternteil lebt.